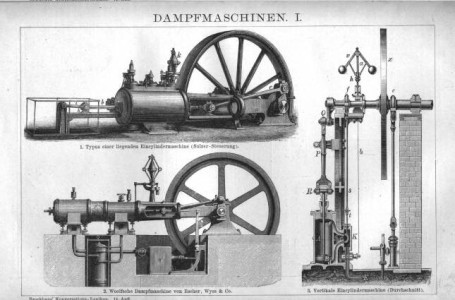-
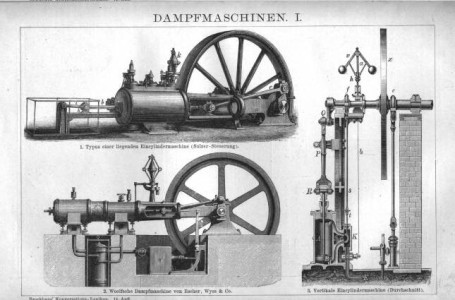
-
Dampfmaschinen
Interessantes und
Wissenswertes aus 300 Jahren
Technikgeschichte
-
Die Erfindung der
Dampfmaschine brachte einen gewaltigen Schub
in der Technisierung und Industrialisierung Europas und der Neuen
Welt. Inzwischen haben Turbinen und Verbrennungsmotoren die
Dampfmaschinen weitgehend als Antriebsquelle abgelöst. Trotzdem
oder gerade deshalb übt die ursprüngliche, einfach durchschaubare
Mechanik der Dampfmaschine heute noch eine große Anziehungskraft
auf Menschen jeden Alters aus.
Das Grundprinzip
Eine Dampfmaschine ist eine mechanische Anlage zur Übertragung der
Energie von Wasserdampf in mechanische Energie. Das Grundprinzip besteht
darin, durch Dampfdruck einen Kolben anzutreiben. Dadurch wird mechanische
Energie erzeugt, die in eine Drehbewegung umgewandelt wird. Der
Wasserdampf wird in der Regel in einem Dampfkessel gewonnen. Die
einfachste Form eines Dampfkessels ist ein geschlossener, mit Wasser gefüllter
Behälter, der mit einer Flamme so lange erhitzt wird, bis das Wasser zu
Dampf wird.
Großtechnische Anlagen zur Erzeugung von Elektrizität sind allerdings
erheblich komplizierter aufgebaut und mit einer Reihe unterschiedlicher
Zusatzgeräte ausgestattet. Der Wirkungsgrad von Dampfmaschinen ist (bis
jetzt) gering. Deshalb wurden sie bei der Elektrizitätserzeugung in den
meisten Fällen durch leistungsfähigere Dampfturbinen ersetzt.
Die Historie
Der französische Physiker und Erfinder Denis Papin entwickelte 1690
die
erste Kolbenkraftmaschine. Die Hauptleistung bei diesem
"primitiven" Gerät wurde mit Luftdruck und nicht mit Dampfdruck
erzielt. Auf den Boden des Zylinders, der gleichzeitig als Kessel diente,
wurde eine geringe Menge Wasser geleitet und erwärmt, bis sich Dampf
bildete. Der Dampfdruck hob einen in den Zylinder eingepassten Kolben. Die erste wirkliche Dampfmaschine baute 1705 der englische Schmied
Thomas Newcomen, mit atmosphärischer Dampfpumpe und einem
zweiarmigen Hebel. Zusammen mit Gegengewichten bewirkte Dampf,
der mit geringem Druck unten in den Zylinder geleitet wurde, dass sich
der Kolben zum oberen Zylinder bewegte. War der Kolben dort angekommen, öffnete
sich automatisch ein Ventil, durch das kaltes Wasser in den Zylinder
gespritzt wurde. Dadurch kondensierte der Dampf, und der Luftdruck schob
den Kolben wieder zum unteren Ende des Zylinders. Die Verbindungsstange
zwischen Kolben und Gegengewicht bewegte den Kolben auf und ab und betätigte
eine Pumpe. Der schottische Ingenieur und Erfinder James Watt erfand 1765
ein Verfahren, bei dem ein sich hin- und herbewegender Kolben ein
Schwungrad antreiben konnte. Das erreichte er zunächst durch ein System
von Zahnrädern, das er später durch eine Kurbelwelle ersetzte. Außerdem
führte er das Prinzip der Doppelwirkung ein, bei der Dampf abwechselnd
auf beide Seiten des Kolbens geleitet wurde, so daß in beide Richtungen
Druck ausgeübt wurde. Zusätzlich rüstete Watt seine Maschinen mit
Drosselklappen aus, um die Dampfzufuhr und die damit abhängige
Geschwindigkeit zu regeln.
Erst Anfang des 19. Jahrhunderts gelang es dem britischen Ingenieur
und Erfinder Richard Trevithick und seinem amerikanischen Kollegen Oliver
Evans, eine Hochdruckdampfmaschine zu konstruieren. Zunächst wurde diese
Art für den Antrieb von Lokomotiven genutzt. Später bauten Trevithick
und Evans auch dampfbetriebene Kutschen.
-
Arten der Dampfmaschine
Wärmekraftmaschine, bei der der Druck,
den Wasserdampf auf einen oder mehrere Kolben ausübt, eine Hubbewegung des
Kolbens im Zylinder bewirkt und über Kolbenstange, Kreuzkopf, Schub- oder
Pleuelstange eine Drehbewegung der Kurbelwelle samt Schwungrad. Bei einer
Tandemdampfmaschine liegen die Zylinder hintereinander. Bei einer
Einfachexpansionsdampfmaschine wird das gesamte Druckgefälle des Dampfes in
einem Zylinder in einer Stufe verarbeitet. Verbunddampfmaschinen (Compound Dampfmaschinen)
sind zweistufige Expansionsdampfmaschinen. Bei Auspuffdampfmaschinen tritt
der verarbeitete Dampf direkt ins Freie, bei Kondensationsdampfmaschinen
tritt er in einen Kondensator ein, in dem er durch Kühlen zu Wasser
verdichtet wird. Bei der Gegendruckdampfmaschine tritt der Abdampf in einen
Raum von höherem als Atmosphärendruck, um u. a. für Heizzwecke entnommen
zu werden.
-
Geschichte:
Die Dampfmaschine wurde 1769 erfunden. Ihre Grundlage war die
Kolbendampfpumpe, und die Dampfmaschine gilt als die erste und wichtigste
Erfindung im 18. Jahrhundert. Die Spannung des Wasserdampfes entdeckten
griechische Gelehrte schon vor Christi Geburt. Man machte im
17.Jahrhundert immer wieder Experimente, diese Kraft auszunutzen. 1705
baute Thomas Newcomen die Kolbendampfpumpe mit geringer Leistung. 1735
stellte man zum ersten Mal Koks her, der bei der Verbrennung viel mehr Wärme
gab als die bisher genutzte Holzkohle.1796 baute James Watt eine Dampfmaschine, bei deren
Konstruktion er all diese Entdeckungen und Erfindungen miteinander verband
und so die Leistung der Maschine entscheidend verbessern konnte
-
Dampf
-
Gasförmiger Aggregatzustand eines Stoffes, der mit
der flüssigen oder festen Phase des gleichen Stoffes im Thermodynamischen
Gleichgewicht steht; zumeist versteht man darunter Wasserdampf. Dampf ist als
Gas unsichtbar, sichtbarer Wasserdampf enthält bereits fein
verteiltes, tröpfchenförmiges Wasser; ein solches Gemisch (z.B. Nebel,
Wolken) wird als Nassdampf bezeichnet. Dampfdichte und Dampfdruck
sind stark temperaturabhängig. Steht der gasförmige Aggregatzustand
nicht im Gleichgewicht mit einer anderen Phase, so spricht man von ungesättigtem
Dampf, sonst von gesättigtem Dampf (Sattdampf). Heißdampf entsteht
durch nachträgliches Erhitzen von gesättigtem Dampf.
-
Der griechische Ingenieur Heron von
Alexandrien, Leonardo da Vinci und der Magdeburger Bürgermeister Otto von
Guericke hatten schon mit Dampf experimentiert. Jedoch die ersten Versuche
eine Dampfmaschine überhaupt zu konstruieren, gehen auf den französischen
Naturforscher Denis Papin zurück, der, angeregt durch Otto von
Guerickes Versuche mit dem Luftdruck (1654), 1689 das Prinzip der atmosphärischen
Dampfmaschine erfand. Er baute einen Messingzylinder, der
mit einem Kolben, erhitzte Wasser im Zylinder, bis der entstehende Dampf
den Kolben bis gegen eine Sperre durch den geschlossenen Zylinder schob.
Entfernte er die Wärmequelle, dann kondensierte der Dampf wieder. Es
bildete sich ein Vakuum, und der äußere Luftdruck presste den Kolben in
den Zylinder zurück. Im selben Jahr entwickelte der Engländer
Thomas Savery eine atmosphärische Dampfpumpe zum Entwässern von
Bergwerken. Er ließ Dampf in einen Behälter strömen und spritzte dann
Wasser ein. Durch Kondensation entstand ein Unterdruck, wodurch das
Grubenwasser in den Behälter gesaugt wurde. Nach dem erneuten Öffnen
eines Ventils strömte wiederum Dampf in den Kessel und drückte durch ein
zweites Ventil das eingesaugte Wasser nach oben in ein Steigrohr. Nachdem nun diese beiden
Naturforscher Experimente mit Dampfmaschinen durchgeführt hatten, bei
denen ständig die Steigrohre und Dampfkessel geplatzt waren, realisierte
1705 der englische Schmied Thomas Newcomen in Devon zusammen mit John
Cawley aufgrund der Papinischen Vorarbeiten erstmals der Bau einer
wirtschaftlich und zuverlässig arbeitenden Dampfmaschine, einer so
genannten Balanciermaschine, deren Grundprinzip noch anderthalb
Jahrhunderte überdauerte. Sie arbeitete mit einem getrennten
Dampfkessel. Ihre Kolbenstange wirkte auf ein Ende eines „Balanciers,
eines Waagbalkens. Strömte Dampf in den Zylinder, dann hob sich der
Kolben, wurde Wasser eingespritzt, kondensierte der Dampf, und der
Luftdruck stieß den Kolben in den Zylinder zurück. Am anderen Ende betätigte
der Balancier eine Pumpe. Bei zwölf Hüben in der Minute förderte die
Pumpe 540l Wasser. Zwei Jahre später baute Papin die
erste Hochdruckdampfmaschine.
1720 entwickelte Newcomen seine
Dampfmaschine, eine Feuermaschine!
1765 verbesserte der schottische Apparatebauer James
Watt die Dampfmaschine, die die Industrie und Wirtschaft grundlegend veränderte.
-
Aufgrund ihrer Konstruktion kam die
Dampfmaschine bislang hauptsächlich als Pumpenantrieb zum Einsatz. Was
aber immer nachdrücklicher gefordert wurde, war eine Maschine, die eine möglichst
gleichmäßige Drehbewegung lieferte, also eine universell einsetzbare
Betriebsmaschine. Diese Forderung erfüllt Watt in folgenden Schritten:
Zunächst geht er von der einfach- zur doppeltwirkenden Maschine über,
indem er die Räume über und unter dem Kolben abwechselnd mit dem
Kondensator verbindet. So kann er beide Kolbenbewegungen als Arbeitshübe
nutzen. Ein Gewicht zum Hochziehen des Kolbens ist nicht mehr nötig. Bei der doppeltwirkenden Maschine
tritt allerdings das Problem auf, dass die Kolbenstange nicht nur auf Zug,
sondern auch auf Druck beansprucht wird. Ihre Geradführung durch Ketten,
wie sie schon Newcomen angewendet hat, ist daher nicht mehr geeignet. Von
den verschiedenen Methoden der von Watt erdachten Geradführungen setzte
sich schließlich die als Wattsches Parallelogramm berühmt gewordene Führung
durch.
-
Der Dampf tritt in den Schieber ein.
Je nachdem welche Seite im Schieber geöffnet ist, tritt der Dampf auf der
Kurbel- oder der Deckelseite in den Zylinder ein. Dort übt er Druck auf
den Kolben aus, welcher wiederum Druck auf die andere Seite des Kolbens
ausübt und dort den Dampf hinaus presst. Der Kolben ist an einer
Kolbenstange befestigt, diese wiederum am Kreuzkopf und dieser bewegt über
eine Pleuelstange die Kröpfung. Diese setzt dann letztendlich über die
Kurbelwelle das Schwungrad in Bewegung. Bei der doppelt wirkenden
Dampfmaschine ist an der Kurbelwelle noch ein Excenter befestigt, welches
den Schieber bewegt. So kann in beide Seiten des Kolbens Dampf eintreten
und das Schwungrad eine Drehbewegung ausführen.
-
Für die Umwandlung der
Pendelbewegung des Balanciers in die geforderte Drehbewegung war jetzt
eigentlich nur noch eine Kurbel notwendig. Ihre Anwendung bei
Dampfmaschinen war jedoch in England patentrechtlich geschützt. Um Ärger
zu ersparen, musste Watt dieses unsinnige Patent umgehen. Dies gelang ihm
durch sein Planetengetriebe, mit dem seine Maschinen bis zum Erlöschen
des Kurbelpatents im Jahre 1794 ausgerüstet wurden. Mit dem
Fliehkraftregler, der je nach Belastung die Dampfzufuhr drosselte und so für
eine annähernd konstante Drehzahl sorgte, war 1787/88 die Forderung nach
einer universell einsetzbaren Betriebsmaschine erfüllt. Unabhängig von
Wassermangel und Windstille und weit über das menschliche und tierische
Leistungsvermögen hinaus konnte die Dampfmaschine jetzt überall und
jederzeit die so dringend benötigte Antriebskraft liefern. Zum gleichmäßigen Lauf der Wattschen Dampfmaschine trägt
der Fliehkraftregler bei.
James Watt (1736-1819) hatte zusammen mit Matthew
Boulton eine Firma, in der sie Dampfmaschinen produzierten. Der
Fliehkraftregler kam 1788 zur Regelung der Drehzahl der Dampfmaschinen
hinzu (die Funktionsweise sollte hinlänglich bekannt sein). Boulton hatte
ihn im Windmühlenbau entdeckt und Watt voller Begeisterung darüber
berichtet. Nachdem sie ihn anfangs noch für Zuschauer unsichtbar
einbauten, da er nicht patentiert war (zumindest nicht im
Dampfmaschinenbau), war er später Blickfang an Boulton & Watts
Dampfmaschinen
-
Watts Maschine trug entscheidend
dazu bei, den Weg für die Serien- und Massenproduktion, für den Großbetrieb,
die Fabrik zu ebnen. Die Industrialisierung mit all ihren sozialen und
betriebswirtschaftlichen Folgen war nicht mehr aufzuhalten. Bereits 1783 hatte die Wattsche
Dampfmaschine alle anderen Pumpen verdrängt. Sie pumpten große
Wassermengen zu einem Fünftel der früheren Kosten aus den Bergwerken und
machten dadurch viele Gruben wieder rentabel.
1790 war Watts Dampfmaschine dann so weit entwickelt, dass sie in
Webereien und Spinnereien die Wasserkraft ersetzen konnte. Die Maschinen wurden jetzt erst voll
leistungsfähig und der Standort der Fabriken war nicht mehr von der
Wasserkraft abhängig. 1801 wurde die Dampfmaschine als
Zugmaschine im Eisengewerbe eingesetzt. Im gleichen Jahr noch kam sie zum
Einsatz in Dampfwagen. 1807 entstand dank ihr das erste
Dampfschiff und 1814 konnte die erste Lokomotive mit
dieser Erfindung die Strecke Nürnberg-Fürth zurücklegen. Die ersten Maschinen waren noch fast
ganz aus Holz gefertigt. Erst 1825 baute Roberts seinen Selfactor zur
automatischen Steuerung der Spinnmaschine ganz aus Metall. Die Folge war,
dass die Eisenindustrie dem ansteigenden Bedarf zunächst hilflos gegenüber
stand. Sie litt unter dem Holzkohlenmangel.
-
1739 gab es in England 60 Hüttenwerke
mit einer Jahresproduktion von 70000 Tonnen- je Tag und Betrieb also eine
durchschnittliche Erzeugung von nicht einmal vier Tonnen. So musste
England Eisen einführen. Alle Versuche, mit Hilfe von Kohle Eisen zu
schmelzen, schlugen fehl oder brachten nur unbefriedigende Ergebnisse. Nachdem Darby dies dann aber doch
gelungen war stieg die Eisenproduktion bis 1796 auf 135000 Tonnen und
erreichte1806 eine Viertelmillion. Zu Beginn des Jahrhunderts mussten die
Briten noch über 60 % des im Lande verarbeiteten Stabeisens einführen,
um1790 konnten sie es exportieren, ebenso wie schon seit langem die Kohle.
Die Englischen Bergwerke verdreifachten im Laufe des Jahrhunderts ihre Förderung. Die
Produktion von Dampfmaschinen
kurbelte also die Eisenindustrie an und ihr Einsatz half den Bergwerken
durch die Kohle mehr Gewinn zu machen.
-
Durch den Einsatz der Dampfmaschine
in Fabriken, änderte sich der Arbeitsplatz der Menschen grundlegend. Die
Fabriken, die sowieso meist ziemlich dreckig und keineswegs hygienisch
waren, wurden noch staubiger und die Arbeiteten mussten Rauch und Ruß
einatmen, den die Maschine erzeugte. Dazu kam noch, dass die
Dampfmaschine in ihren Anfängen immer wieder explodieren konnte. Bei
solchen, so genannten Kesselexplosionen wurden damals Hunderte von
Menschen getötet und verletzt und ganze Fabriken zerstört. Nicht ungefährlich war, besonders
in der Anfangszeit, der Einsatz von Dampfmaschinen, da es immer wieder zu
Kesselexplosionen kam. Die Explosionen entstanden durch plötzlichen
Überdruck, bei dem unversehens Dampf austreten und im Extremfall zu einer
Explosion führen konnte. Die Folgen waren jedes Mal
verheerend. Aus diesem Grund war die
Dampfmaschine- und damit der Arbeitsbereich des Maschinisten- von der
Fabrikhalle räumlich getrennt. Das hatte eine gewisse Einsamkeit des
Maschinisten, der sich bereits durch seine Spezialistenrolle in der Fabrik
von den übrigen Arbeiterinnen buchstäblich „abhob, zur Folge. Der Beruf des Maschinisten in einer
Fabrik, deren gesamte Produktion vom klaglosen Funktionieren der
Dampfmaschine abhing, war nämlich dementsprechend verantwortungsvoll. Er
musste nicht nur entsprechendes technisches Verständnis und Gespür für
die Dampfmaschine haben, sondern auch imstande sein, Schäden und sich
abzeichnende Probleme rechtzeitig zu erkennen, einzugreifen und nötige
Reparaturen selbständig durchzuführen.
-
England war die Führungsrolle in
dieser Epoche zugeschrieben. Die Ursache dafür war ihre Erfindergabe, die
England zum Mutterland der Technik machte und hierfür trug die Erfindung
der Dampfmaschine ganz besonders bei. Denn durch diese Erfindung begann
die Industrialisierung erst richtig ins Rollen zu kommen und ermöglichte
unseren Fortschritt in der Technik.
-
-
-